
Medigene geht in die Insolvenz
Einem Urgestein der Münchner Biotechnologie-Szene, der 1994 gegründeten Medigene AG, geht die Puste aus. Nach der kürzlichen Mitteilung zur Verlustanzeige des Grundkapitals haben Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens den Weg zum Amtsgericht eingeschlagen, um dort die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Nach Morphosys verschwindet damit das letzte große "M" der Firmennamen im Münchner Biotechnologie-Cluster, nachdem die Firma Micromet schon 2012 von Amgen aufgekauft worden war.
Nach der Verlustanzeige zum Grundkapital nun der Insolvenzantrag. Die Geschichte des Biotechnologieunternehmens Medigene ist ein Spiegelbild der Geschichte der Branche von ihren Anfängen. Als Medigene 1994 als Ausgründung des Genzentrums in München entstand, waren die Gründerväter Ernst-Ludwig Winnacker und Horst Domdey bestrebt, dem Bundesforschungsministerium das Gebiet schmackhaft zu machen, nachdem Deutschland im Begriff war, den sichtbaren Erfolg der ersten US-amerikanischen Biotech-Unternehmen wie Genentech, Biogen und Amgen zu verschlafen. Dies hatte mit der Verweigerung der biotechnologischen Insulinproduktion bei Hoechst zu tun und einem restriktiven Gentechnikrecht, das mehr verhinderte als zuließ.
Das Signal des damaligen BMFT mit Jürgen Rüttgers und Ekkehard Warmuth war ein neuartiger Förderwettbewerb, statt eines altbekannten Förderprogramms. Der BioRegio-Wettbewerb brachte dann die Gründerszene der deutschen Biotechnologie Mitte der 90er Jahre richtig in Bewegung. Horst Domdey wechselte nach kurzer Zeit von Medigene in die von ihm gegründete Clusterorganisation BioM, mit der er die Entwicklung des gesamten Ökosystems aus Investoren, Gründern, Wissenschaft mit der durch freundschaftliche Beziehungen stabilen politischen Unterstützung im bayerischen Wirtschaftsministerium maßgeblich voranbrachte. Winnacker blieb lange Aufsichtsrat in der nun von Peter Heinrich, ehemals bei der bayerischen Chemiefirma Wacker beschäftigt, geführten Medigene. Mitten in der Aufschwungphase des Neuen Marktes gelang im Jahr 2000 der Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die ursprünglich als Kardiologie-Unternehmen gegründete Medigene verließ dieses Gebiet bald wieder und erweiterte in den darauffolgenden Jahren das Portfolio durch die Übernahme mehrerer Biotech-Firmen, darunter NeuroVir und Avidex, und erhielt in Deutschland die Zulassung für das Krebsmedikament Eligard. 2006 wurde mit Veregen erstmals das biopharmazeutische Produkt eines deutschen Biotech-Unternehmens in den USA von der FDA zugelassen. Keines dieser Medikamente war selbst erfunden oder erforscht worden, sondern aus Hinterlassenschaften von anderen Pharmaunternehmen übernommen. Dennoch war Medigene eine gewisse Zeit ein Vorzeigeunternehmen der Region und der gesamtdeutschen Branche, da man den mühevollen Weg der Zulassungserteilung gleich mehrfach erfolgreich absolviert hatte.
Zwischen 2012 und 2014 richtete sich Medigene strategisch neu aus, indem es seine Produkte Eligard, EndoTAG und RhuDex veräußerte. Der Fokus wurde erneut komplett verändert und auf die Zelltherapie in der Immunonkologie gelegt. Medigene war in diesem Bereich kein Pionier, was den bekannten US-amerikanischen Kommentator der Biotech-Szene John Caroll dazu veranlasste, Medigene als bloßen „Mitspieler“ (new gambler in immunoncology) zu bezeichnen. Wissenschaftlich war Medigene jedoch durchaus aufgrund der Übernahme von Trianta Immunotherapies, der frischen Ausgründung der Immunologie-Expertin Dolores Schendel, exzellent aufgestellt. Doch der lange, teure und mühevolle Weg der klinischen Entwicklung von T-Zell-Therapeutika war völlig unterschätzt worden. Die Möglichkeiten für klinische Studien in dem Bereich waren in Deutschland damals nicht gegeben, deshalb musste man beispielsweise nach Norwegen ausweichen.
Eine Fülle von Partnerschaften bis hin zu einer Kooperation mit der Mainzer BioNTech SE waren nicht so tragfähig, dass daraus der langersehnte große Deal erwuchs, der die Firma entweder auf ein solides Fundament gestellt oder aber einen für alle Beteiligten erfolgreichen Exit ergeben hätte. Im heftigen Personalkarusell der Vorstandsebene mag sich eine weitere Eigenheit der deutschen Biotech-Szene wiederfinden: die Gründer und Taufpaten sehen das Unternehmen allzu lange als ihr „Baby“ an und verhindern mit einer gewissen Beharrungstendenz die notwendigen Veränderungen zum richtigen Zeitpunkt. Nun sind die allermeisten hinterher immer schlauer, doch bei Medigene schwangen in den vielen Wechseln des Personals auch immer Verletzungen und persönliche Kränkungen mit, die den Nachfolgern in der brodelnden Gerüchteküche der Biotech-Gemeinde oft den Neustart nicht gerade erleichterten. Dass Medigene viele Jahre in den einschlägigen Listen des Schutzbundes der Kleinanleger als die schlimmsten „Geldvernichter“ aller börsennotierten Unternehmen aufgeführt wurde, wäre eine eigene Erzählung und die Auflistung der gesamten eingesammelten und nun in der Insolvenz endgültig verlorenen Millionenbeträge wert. Wer ist nun schuld am Niedergang? Ein persönlich zu eng verwobener Aufsichtsrat, der zwar Veränderungen im Management, aber kaum bei sich selbst vorgenommen hat? Ein Aufsichtsratchef, für den der Begriff „aktivistischer Aufsichtsrat“ erfunden werden müsste? Ein zu häufiger Strategiewechsel, der jedoch immer zu spät erfolgte, während echte Vorreiter des Feldes schon deutlichen Vorsprung erreicht hatten? Ein Mangel an Geld, das nie dann üppig hereingeholt werden konnte, wenn es am dringendsten gebraucht worden wäre? Das Fehlen einer eigenen Technologieplattform, die ein Grundrauschen an Einnahmen über Dienstleistungen hätte einbringen können (die Sequenzierungseinheit Medigenomix hatte man früh abgespalten, die sich ihrerseits gut entwickelte und später in Eurofins Genomics aufging)? Hängt alles mit allem zusammen und die Vielzahl der verpassten und nicht rechtzeitig angegangen Chancen waren dann einfach zu viele ausgelassene Möglichkeiten?
Jeder Akteur des Unternehmens wird eigene Perspektiven aus seiner Zeit dazustellen. Auf kurzfristige Nachfrage von |transkript.de zeigte sich niemand bereit, zum letzten Akt des Unternehmens einen Kommentar abgeben zu wollen. Der aktuelle Vorstand hatte schließlich kaum noch eine Chance mit den vorhandenen Assets der T-Zell-Rezeptoren auf dem Weltmarkt der Innovationen mithalten zu können. Vielleicht war auch deshalb das Engagement zumindest von außen betrachtet ein wenig halbherzig. Von den „3M“ des Münchner Biotechnologie-Clusters nimmt Medigene beim Schlussakt die unerfreulichste Abfahrt in die Insolvenz, während Morphosys und Micromet mit ihren milliardenschweren Exits zwar auch keine Nachhaltigkeit für das Münchner Ökosystem der Biotechnologie bringen – außer mit den dort ausgebildeten und an den Unternehmensgeschichten gereiften Köpfen –, aber immerhin ein paar Aktionäre glücklich gemacht haben. Das kann man bei Medigene wirklich nicht behaupten.

 istockphoto.com/artisteer
istockphoto.com/artisteer Roche
Roche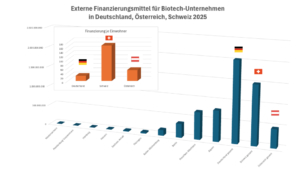 Knowbio GmbH
Knowbio GmbH