
Wacker teilt die Produktionsexpertise mit Start-ups
Eigentlich war der Workshop im neuen Wacker-Forschungszentrum in München-Sendling auch der Besichtigung der neuen Räumlichkeiten gewidmet. Doch der Zuspruch war so groß, dass man auf das ältere Gebäude nebenan ausweichen musste, um mit zahlreichen weiteren Akteuren der frühen Wirkstoffentwicklung – von Wissenschaftlern über Gründerzentren bis hin zu Investoren – die aktuelle Situation zu erörtern. Motto: Gemeinsam geht es besser.
Die Firma Wacker lud im September zu einem Symposium über „RNA-Therapien – von F&E zur GMP-Produktion” und verband dies mit einem Aufruf an das Start-up-Ökosystem, sich frühzeitig mit den späten Phasen der eigenen Wirkstoffentwicklung zu beschäftigen. Dem Ruf wurde so zahlreich gefolgt, dass die Pläne zur Nutzung des neuen Wacker-Forschungsgebäudes am Anfang der Zielstattstraße in München zugunsten des größeren Casinos in den älteren Gebäudeteilen des eigenen Forschungscampus geändert werden mussten.
Das Programm hielt eine bunte Mischung aus einigen Start-up-Präsentationen, Investoren-Darstellungen des HTGF und Expertenwissen der Produktionsfachleute von Wacker bereit. Dabei wurde auch deutlich, dass sich das Unternehmen beständig und fast ein wenig bedächtig in das Feld der biopharmazeutischen Produktion hineinentwickelt hat – zum großen Teil durch Zukäufe in Ostdeutschland (in Jena und Halle), in Amsterdam, aber auch in San Diego (USA), sodass nun ein Netzwerk an Expertise in der Pharmaproduktion die westliche Hemisphäre des Globus umspannt. In Asien ist Wacker zwar ebenfalls sehr aktiv, jedoch werden die fast 40% des Jahresumsatzes, die diese Region in die Wacker-Chemie-Bilanz einbringt, im Wesentlichen über chemische Produkte und nun auch verstärkt über die eigene Produktion vor Ort erwirtschaftet. Wacker Biotech/Pharma hält sich dort eher bedeckt, der Schwerpunkt bleibt Europa und die USA.
Dies liegt vermutlich auch daran, dass sich Wacker über die Jahre sehr stark auf die Produktion von mRNA-Therapeutika fokussierte, wofür der Zukauf aus Amsterdam eine wesentliche Rolle spielte. Dies stellte sich in der Pandemie als weise Strategie heraus, ist insgesamt aber nur eine von sechs Technologieplattformen im Hause Wacker: daneben geht es um lösliche rekombinante Proteine, unlösliche rekombinante Proteine, Plasmid-DNA, lebende mikrobielle Produkte und auch klassische polysaccharid-konjugierte Vakzine. Doch nach einer Pandemie ist vor der nächsten, sodass die Bundesregierung ein Auswahlverfahren zur Vorhaltung von Produktionskapazitäten für einen solchen Fall aufrief, bei dem Wacker in einem Konsortium mit CordenPharma einen Zuschlag erhielt.
Pandemie-Preparedness als Stabilisierung
Um die geforderte Produktionsbereitschaft von 80 Millionen Impfstoffdosen zu erreichen, nutzte Wacker den Zuschlag, investierte 100 Mio. Euro und baute den Standort Halle (Saale) zum Kompetenzzentrum für die mRNA-Produktion aus. Etwa die Hälfte der dort in nur 24 Monaten geplanten und gebauten Produktionsanlagen und ihrer Kapazitäten ist nun für den Bund reserviert. Wie viel Geld der Bund für das Vorhalten einzelner Kapazitäten zahlt, ist offiziell nicht bekannt. Indirekt konnte man jedoch durch das frühzeitige Zurückziehen der Firmen Celonic und GSK aus dem bestehenden Vertrag mit dem Bund eine Abschätzung über die im Haushalt frei werdenden Summen ableiten. Nach dem Rückzug von Celonic standen schätzungsweise 50 bis 56 Mio. Euro neu im Haushalt zur Verfügung. GSK trat später vom Vertrag zurück, die Abschätzung dort ist noch nicht ganz nachvollziehbar. Die im Mai 2022 geschlossenen Verträge umfassen bis Ende 2029 Gelder in Höhe von 2,861 Mrd. Euro. Die fünf ursprünglich ausgewählten Unternehmen stellen unterschiedliche Arten von Impfstoffen her. Mit dieser „Portfolio“-Idee soll sichergestellt werden, dass im Ernstfall auf die notwendige Technologie zurückgegriffen werden kann. Ebenfalls Teil der Pandemie-Preparedness-Gruppe sind IDT Biologika, BioNTech und eben Wacker. Die Bundesgelder waren in den Folgejahren unterschiedlich gewichtet und berücksichtigten die höheren Kosten der Aufbauphase von Produktionskapazitäten. Für die damals fünf Verträge waren insgesamt für 2024 544 Mio. Euro geplant, für 2025 sind es sogar 604 Mio. Euro. Für das Jahr 2027 waren es laut bisheriger Planung bis zu 563 Mio. Euro, für 2028 bis zu 326 Mio. Euro und für 2029 schließlich noch bis zu 59 Mio. Euro. Diese Zahlen können nun zwar durch den Ausstieg von Celonic und GSK deutlich nach unten korrigiert werden. Für die weiterhin beteiligten Unternehmen bleiben die Bundesmittel aber auch ein Stabilitätsanker für das Vorhalten der Produktionskapazitäten.
Kooperation ist Trumpf bei der Produktion
Zurück zum Experten-Workshop. Die Beiträge auf einigen Podiumsdiskussionen machten deutlich, dass die wichtigste Erkenntnis für ein Start-up sein dürfte, sich frühestmöglich mit echten Experten über die nächsten Schritte auszutauschen. Dass dies beim Schritt aus der akademischen Umgebung, in der die Industrie eher keine Rolle oder eine eher schlecht beleumundete spielte, besonders gern vernachlässigt wird, zeigten einige der präsentierenden Start-ups ganz offen. Nicht alles könne der Investor beisteuern, ließ es der Vertreter des HTGF anklingen, aber auch nicht jeder Fehler müsse immer wieder aufs Neue durchexerziert werden.
Für Dr. Guido Seidel, Vizepräsident BioPharma und Geschäftsführer von Wacker Biotech, ist das Wacker-Netzwerk in den aktuell unsicheren Zeiten von Zollstreitigkeiten und Handelserschwernissen eine sehr gute Basis, die Wellenbewegungen auszugleichen. Auch die Anfragen aus beiden Bereichen, den etablierten Pharmafirmen und den Start-ups, trügen dazu bei, dass sich diese Nachfrage aus Sicht von Wacker wie bei kommunizierenden Röhren ausgleiche. Doch die Lage bei den Start-ups habe sich geändert. „Nur wer wirklich die Finanzierung gesichert hat, kommt auch mit der Anfrage zu uns“, so Seidel. Auf der anderen Seite beobachte er, dass Firmen viel stärker zusammenarbeiten, um Schwächen auf der Finanzierungsseite auszugleichen. „Die Leute brauchen sich mehr, arbeiten mehr zusammen und kommen damit auch schrittweise voran“, schildert er die Lagebeobachtung aus seiner Warte.
Das Symposium machte deutlich, dass man in schwierigeren Zeiten als Start-up nur dann eine Chance hat, wenn man genau weiß, worin die eigene Lösungskompetenz liegt, warum das geplante Produkt einen Unterschied machen wird. Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Entwicklung stünden genug externe Experten für die Begleitung bereit, die man ansprechen könne, gerade an einem Standort wie der Münchner Region. Dazu benötige man eine gute Kommunikation mit allen Akteuren und das Durchhaltevermögen, das Vertrauen in die eigene Zähigkeit, sich auch von Rückschlägen nicht abbringen zu lassen.
„Gerade in der Rückbesinnung auf Europa als eigener Innovationsmarkt liegt eine große Chance“, schlussfolgert Seidel. Dass es dabei auch global auf und ab gehen könne und es zu Konsolidierungen und Neujustierungen von Trendthemen komme, sei das Normalste der Welt, so der Experte.

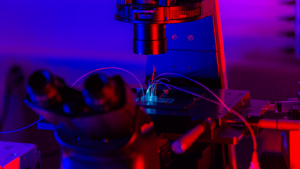 Memo Therapeutics AG
Memo Therapeutics AG Sartorius AG
Sartorius AG Lonza Gruppe
Lonza Gruppe