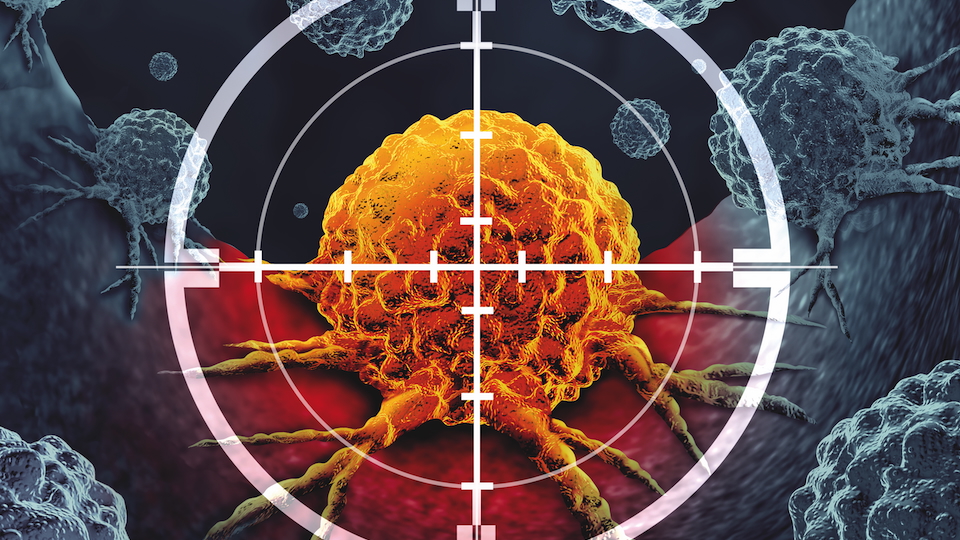
 Krebspipeline der Biotech-Unternehmen der DACH-Region
Krebspipeline der Biotech-Unternehmen der DACH-Region
Krebs im Fokus: Die Onkologie ist der Schwerpunkt der Biotechnologieunternehmen in der Medikamentenentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Pipeline umfasst eine große Zahl von frühen Projekten, doch was tut sich später an der Schwelle zum Patienten? Der Versuch eines Überblicks im Februar 2025.
Einmal jährlich macht der Weltkrebstag Anfang Februar auf die als „Geißel der Menschheit“ bezeichnete Krankheit aufmerksam und in vielen Medien werden die persönlichen Geschichten von Betroffenen und ihre Schicksale ausgebreitet. Wer in Auflagen- oder Klickzahlen für derartige Berichte, Artikel oder Posts in den sozialen Kanälen rechnet, kann sich sicher sein, dass die Resonanz hoch ist. Auch deswegen, weil die zweithäufigste Todesursache in Deutschland (nach den eigentlich an Nummer eins stehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen) im Krankheitsverlauf eine sehr ausgeprägte Wirkung auch auf das Umfeld von Patienten entfaltet. Anders gesagt: Es herrscht deutlich mehr Angst vor dieser Krankheit als vor einer der vielen Erkrankungsformen am Herzen.
Regelmäßig hört man daher von Initiativen aus der Politik und Forschung, den Krebs nun endlich besiegen zu wollen. Joe Bidens „Moonshot“-Programm, internationale, europäische und nationale Strategien zur Entwicklung neuer und heilender Therapien werden regelmäßig proklamiert und in Förderprogramme umgemünzt. Der Erkenntnisgewinn über die vielen verschiedenen Formen einzelner Krebsarten, ihrer Eigenarten und ihrer Entstehungsgeschichte ist dadurch über die vergangenen Jahrzehnte gewaltig angewachsen.
Viel Forschung und Wissen
Damit ist auch in einzelnen Indikationen von Krebsarten ein gewaltiger Fortschritt erzielt worden, die Lebenszeit von neudiagnostizierten Krebsbetroffenen konnte dabei gesteigert werden. Im Durchschnitt beträgt heute die 5-Jahres-Überlebenszeit in westlichen Ländern zwischen 65–70%. In den 1970er Jahren lag diese bei etwa 50% mit den damals gängigen Methoden: Stahl, Strahl und Chemotherapie. So wenig Fortschritt? Im Detail nachgeschaut heißt dies jedoch, dass es in bestimmten Indikationen noch immer kaum eine Verbesserung gibt (etwa bei Pankreaskarzinom oder Glioblastom). In anderen Indikationen kann fast von Heilung gesprochen werden (bestimmte Blutkrebsarten). Vielfach konnte aus dem früheren sicheren Todesurteil eine chronische Erkrankung gemacht werden, die gegebenfalls auch relativ gut zu kontrollieren ist. Im letzteren Bereich hat dazu ein sehr viel besseres Verständnis über die Mechanismen der Krebsentstehung ebenso beigetragen wie eine Armada von unterschiedlichen Therapieformen, die das Immunsystem des Patienten einmal extra anregen oder auch extra dämpfen, um einerseits die Krebszelle stärker zu attackieren oder andererseits unerwünschte Nebenwirkungen wie einen Zytokinsturm zu vermeiden.
Woher stammt die Innovation?
Warum tut sich die Wissenschaft und die innovative Industrie dennoch so schwer, die besonders aggressiven Krebsformen unter Kontrolle zu bringen, und auch dort, wenn schon keine Heilung, dann doch eine in vernünftiger Lebensqualität gestaltbare Chronifizierung von diesen Angstmacherkrebsformen zu erreichen? Und welche Rolle im Wettlauf der Innovationen spielen die über die Jahre mit viel Geld ausgestatteten Biotechnologiefirmen in der DACH-Region? Passend zum Weltkrebstag hat das Europäische Patentamt (EPA) Anfang Februar einmal genauer hingesehen, woher eigentlich die innovativen Medikamente gegen Krebs stammen, wie Deutschland und Europa im Wettbewerb mit anderen Nationen dastehen. Das Ergebnis wird Fachleute nicht überraschen, es ist ernüchternd.
USA führt, Europa hinkt
Das EPA hat dazu die bei diesem Patentamt eingereichten internationalen Patentanmeldungen (International Patent Families) im Bereich Krebs analysiert. International bedeutet dabei, dass der Antragsteller mindestens in zwei verschiedenen Ländern nach einer Patent-erteilung nachgesucht hat. Der Report „Patents and Innovation against Cancer“ liefert eine Fülle von Daten über die vergangenen Jahrzehnte. Unumstrittener globaler Führer in Sachen Patentanmeldungen waren und sind die USA.
Der enorme, fast sprunghafte Anstieg der Patentierungsaktivitäten seit etwa 2015 (siehe die Grafik im verlinkten PDF am Ende des Artikels) ist sogar zum ganz überwiegenden Teil einer etwa 60%igen Steigerung der immer schon hohen Patentierungsaktivitäten aus den USA geschuldet. Auf niedrigerem Niveau ist auch die Steigerung um satte 300%, die die Volksrepublik China mit Patentierungen beim Europäischen Patentamt in der Zeitspanne von 2016 bis 2021 vorzuweisen hat, ein Treiber für die massive Erhöhung der jährlich eingereichten Patentanmeldung auf fast 13.000 internationale Anträge zu Therapeutika, Diagnostika und technologischen Erfindungen – jährlich. Davon steuerten die USA im Jahr 2020 bei den Therapeutika über 5.500 Anmeldungen bei, China über 2.000, die EU27 etwa 1.700. Damit haben sich die europäischen Länder im Verlauf der vergangenen 20 Jahre der Datenanalyse (2001–2021) etwa um den Faktor 1,4 verbessert, liefern aber gerade im vergangenen Jahrzehnt der Betrachtung kaum noch eine Steigerung zum damaligen Stand von 2010.
Insgesamt machen Anmeldungen aus den USA im Bereich der Krebsforschung fast 50% aller Internationalen Patentfamilien (IPFs) beim EPA von 2002 bis 2021 aus. Eine Position, die in den vergangenen Jahren durch starke Innovationsökosysteme und massive öffentliche Finanzierung gestärkt worden sei, wie das EPA betont. Europa belegt zwar noch den zweiten Platz über diesen Gesamtzeitraum, der Abstand zur USA wächst jedoch, während China in beeindruckendem Tempo aufholt.
Deutschland schwächelt
Der Report geht auch auf einzelne Länder im Detail ein und weist Deutschland zwar noch als das führende Land in Europa aus, das beim Thema Krebs neue Erkenntnisse in einer Patentschrift ausformuliert. Doch die jährlich zwischen 450 bis 500 eingereichten Patentanmeldungen sind seit 2002 relativ gleichbleibend und zeigen in den vergangenen Jahren eher eine absteigende Tendenz.
Dies ist in verschiedenen Nachbarländern deutlich anders: Die Patent-ierungsaktivitäten des Vereinigten Königreichs haben seit 2014 deutlich zugenommen und sich seit 2002 etwa verdoppelt auf eine jährliche Anmeldungszahl in ähnlicher Größenordnung wie Deutschland. Besonders stark angewachsen sind die Aktivitäten der Schweizer Forscher, die aktuell über 350 Patentfamilien jährlich anmelden und sich damit in ihren Anstrengungen im Kampf gegen den Krebs seit 2002 um den Faktor 3,5 deutlich gesteigert haben. Frankreich hat eine Verdoppelung der Anmeldungen seit 2002 vorzuweisen, die Niederlande sogar fast eine Verfünffachung. Würde man diese Auflistung auf die Bevölkerung des jeweiligen Landes umrechnen, kommt das den Fachleuten bekannte Bild heraus: die Schweiz als überdeutlicher Innovationsführer (was hierbei aber zum ganz großen Teil an der starken Patentaktivität der Firma Roche liegt, die ihrerseits etwa die Hälfte der eingereichten Patente aus ihrem Genentech-Forschungszentrum in den USA bezieht), gefolgt von Dänemark und Luxemburg (!), den Niederlanden, Schweden und Belgien. Deutschland liegt in einer solchen Auflistung an Position acht der EU27-Länder, auch noch hinter Irland.
Unis machen Patente …
Die Analyse des Europäischen Patentamts beleuchtet auch die technologischen Neuerungen. Demnach werde der Anstieg an Innovationen im Bereich der Krebsforschung hauptsächlich durch neue Technologien vorangetrieben – von Immuntherapie und Gentherapie bis hin zu digitalen Technologien wie KI –, die vielversprechende neue Wege für Diagnose und Behandlung eröffnen. Die eigentlichen Erfindungen stammen oft aus der Grundlagenforschung, wobei allein Universitäten und öffentliche Forschungseinrichtungen fast ein Drittel der Patentaktivitäten ausmachen. Die meisten Patentanmeldungen stammen von der University of California, die Schweizer Roche folgt unter den globalen Einreichern auf Platz zwei. Doch auch französische Forschungsstätten wie INSERM und CNRS finden sich unter den TOP 5. In Deutschland weniger bekannt ist, dass es die Grundlagenforschung der Max-Planck-Gesellschaft ist, die bei der Anmeldung von 154 Patentfamilien sogar leicht vor dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ, 152 Patentfamilien) liegt, auf dem dritten Platz innerhalb Deutschlands folgt die Universität Heidelberg mit 132 Patentfamilien.
… Firmen machen Innovation
Doch was passiert mit all diesen akademischen, öffentlich finanzierten Patenten, und wo? Mittlerweile ist es ein Gemeinplatz, dass sich die große Pharmaindustrie die Innovation von außen hereinholt und nur etwa ein Drittel der von ihr zur Zulassung gebrachten Medikamente aus der eigenen Forschung stammt. Stattdessen bedient sich Big Pharma bei den Instituten und Start-ups. Doch dass es im Bereich der Start-up-Kultur zwischen den Kontinenten beiderseits des Atlantiks große Unterschiede gibt, ist ebenfalls schon Allgemeinwissen. So macht der Report auch deutlich, dass Europa zwar in der Gesamtzahl an Start-ups im Bereich Krebs (laut eigener EPA-Definition etwa 1.500) die USA sogar überflügelt (rund 1.325 solche Start-ups). Doch das Wachstum dieser Firmen, die mit Patenten aus dem naheliegenden Forschungsinstitut ausgestattet ihre Firmengeschichte beginnen, findet dann in gänzlich verschiedenen Ökosystemen statt – oder in Europa nur in Einzelfällen bis zur Zulassung.
Pipeline bleibt ewig-früh
Blickt man auf den echten Output der Biotechnologie-Szene in Deutschland, so stammt das zuletzt zugelassene Krebsmedikament Monjuvi aus dem Jahr 2020. Die entwickelnde Firma Morphosys aus Planegg-Martinsried gibt es nach dem Aufkauf durch Novartis und folgende Schließung der Forschungsstätte schon bald nicht mehr. Davor waren nur zwei andere Biotech-Unternehmen, ebenfalls aus München, mit einer Zulassung in der Onkologie erfolgreich: Trion Pharma/Fresenius Biotech im Jahr 2009 und Micromet, die in einem Milliardendeal durch Amgen aufgekauft wurde, bevor Blincyto/Blinatumomab schließlich 2014 durch die FDA erstmalig zugelassen wurde.
Dabei ist es eine durchaus große Zahl an Start-ups, die mit neuen Ansätzen den Krebs zu bekämpfen versucht, rechnet man auch diejenigen dazu, die noch in der frühen, präklinischen Phase stecken. Dort (in der Präklinik) oder bei den immerhin 78 Projekten in der ersten klinischen Bewährungsprobe in der Sicherheitstestung der Phase I ist die Pipeline in Deutschland, Österreich und der Schweiz gut bestückt. Sie wird jedoch sehr überschaubar ab der Phase II, auch weil einige spätere Assets von Pharmafirmen weggekauft worden sind (eine Übersichtstabelle mit Darstellung in welcher Phase sich die Wirkstoffentwicklung einzelner Firmen im DACH-Raum befindet, findet sich im verlinkten PDF am Ende des Artikels).
Hoffnung bei 4SC*
Blickt man auf das gesammelte Firmen-ABC der klinischen Projekte in den Biotechnologieunternehmen (siehe ausführliche Tabelle der DACH-Region), wobei die ganz Großen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck, Novartis und Roche hier außen vor gelassen sind, so trifft es sich wie selten, dass die erste Firma einer solchen Liste auch am weitesten vorangekommen ist. Für viele überraschend ist das die 4SC AG (wiederum aus dem Münchner Krebs-Biotech-Cluster), von der man lange Zeit nichs gehört hat. Sie befindet sich jedoch in der allerletzten Phase des Zulassungsprozesses ihres Krebsmedikamentes Resminostat. Endlich, werden viele Aktionäre sagen, die das Auf und Ab dieser Firma mitverfolgt oder leibhaftig am Kursverlauf der Aktie miterlebt haben.
Gerade liegt der Ball wieder und wohl ein letztes Mal bei der EMA, die über den Jahreswechsel noch eine lange Liste letzter Fragen zum eingereichten Dossier und den Daten aus der Phase III-Studie nach Martinsried geschickt hatte. Diese habe das Management um CEO Jason Loveridge vollumfänglich kürzlich beantwortet nach Amsterdam zurückgeschickt(*). Mit im Boot sind hier als Hauptaktionäre die Gebrüder Strüngmann, die vermutlich ebenfalls auf die frohe Botschaft einer Zulassungsempfehlung durch den Ausschuss für Humanmedizin (CHMP) warten dürften. Dann jedoch könnte es für 4SC schwierig werden, die nächsten Schritte zum Markt und zu den Patienten gehen zu können. Denn es könnte am Geld fehlen. (*mittlerweile hat sich die Situation jedoch anders entwickelt, und derzeit hat die EMA eine Zulassung abgelehnt. Fortsetzung folgt, oder das Ende der Geschichte? Das ist derzeit noch unklar.)
Zulassung kein Lottogewinn
Zwar haben die Gebrüder Strüngmann über ihre Santo Holding erst im vergangenen September nochmals 4 Mio. Euro bei einer Kapitalerhöhung zugeschossen, doch die gesamte Marktkapitalisierung der 4SC AG ist trotz eines aussichtsreichen Krebsmedikamentes auf einen Minimalwert von etwas über 60 Mio. Euro zusammengeschrumpft, die Aktie durch viele Splits im Zeitverlauf für den Kleinanleger kaum jemals wieder in den grünen Bereich zu heben. Damit alleine wird keine Finanzkraft entfaltet werden können, die eine eigenständige Kommerizialisierung des Wirkstoffs bräuchte. Also? Entweder die Milliardäre öffnen nochmals ihre Tresore oder aber der finanzkräftige Partner muss aus dem Hut gezaubert werden. Der Erfolg bei der EMA könnte damit gleichsam das Ende des Unternehmens einläuten, auch das kennt man in Martinsried. Vor gut 15 Jahren brachte auch die Zulassung eines Krebsantikörpers der Trion Pharma und ihrem Partner Fresenius Biotech kein Glück und keinen Markterfolg – just zum Redaktionsschluss gemeldet, war in einem zweiten Versuch des Erfinders Horst Lindhofer unter neuer Firmierung der Lindis Biotech die EU-Zulassung erfolgreich.
Powerhouse Biontech
Ganz anders und sehr breitbeinig stellt sich dagegen die Mainzer Biontech auf die Krebsbühne, nachdem das Image als Impfstoffentwickler zunehmend lästig wird und abgestreift werden soll. Zwar bringt die Anpassung des COVID-Impfstoffes noch immer regelmäßig schönes Geld in die Kassen, doch der hohe Forschungsetat frisst dieses wieder auf – so schreiben die einstigen Impfstoff-Helden neuerdings rote Zahlen, wenn man den großen Schatz mit einem zweistelligen Milliardenbetrag im Keller der Mainzer Goldgrube unberücksichtigt lässt. Das viele Geld fließt in so viele Krebsprojekte – die ursprüngliche Gründungsidee und -vision von Biontech –, dass CEO Ugur Sahin im vergangenen Jahr kurzzeitig selbst die Übersicht zu verlieren schien, als er auf Pressekonferenzen von „mindestens zehn zulassungsrelevanten klinischen Studien im laufenden Jahr“ berichtete. So, als könnten es auch leicht 12 oder 15 sein und mit ihrer finanziellen Feuerkraft wäre das auch für ein Großunternehmen wie Biontech von der Zahl her nicht so bedeutend, weil auf jeden Fall „schon etwas“ dabei herauskommen würde.
Im Jahr 2025 hörte es sich deutlich übersichtlicher und auch ein wenig bescheidener an, als Sahin auf der JPMorgan-Konferenz die aktuelle Marschrichtung in Sachen Krebs beschrieb. Als dort nach wenigen Minuten während der Präsentation ein Wecker unvermittelt klingelte, wähnte sich Sahin erschrocken schon fast am schnellen Ende seiner Redezeit, doch er durfte fortfahren und damit auch etwas tiefer einsteigen in die neue, fokussiertere onkologische Strategie, die nun drei Bereiche umfasst:
- mRNA Immuntherapien: Ziel ist es dort, neue Immunantworten gegen tumorassoziierte Antigene (personalisiert) und Mutationen (individualisiert) im frühen Krankheitsstadium und in der adjuvanten Phase zu induzieren
- Immunmodulatoren: Fokus auf bispezifische Moleküle, die auf mehr als ein Ziel ausgerichtet sind. Diese Moleküle sollen ein grundlegender Bestandteil von Behandlungsschemata für verschiedene Krebsarten werden: Sie könnten auch die Effektivität von therapeutischen mRNA-Krebsimpfstoffen und anderen Therapien durch ihren dualen Targeting-Mechanismus erhöhen — insbesondere bei fortgeschrittenen Tumoren, bei denen die Tumormasse bereits hoch ist (BNT327 ist eine solche Plattform).
- zielgerichtete Therapien (etwa ADCs): Diese Modalitäten böten präzise Mechanismen zur Bekämpfung von Krebszellen und eröffnen neue Möglichkeiten für Kombinationstherapien, insbesondere zur Bekämpfung großer, metastasierender Tumoren.
Fokus nun auch in Mainz
Speziell für 2025 haben sich die Mainzer genau zwei Schwerpunkte gesetzt und fokussieren auf mRNA und BNT327. Die ansonsten enorm breit aufgestellte Pipeline – die durchaus weiterverfolgt wird, jedoch laut Unternehmensangaben mit etwas weniger Kraftaufwand – überstrahlt jede andere Anstrengung einer Biotechnologiefirma im DACH-Raum. Auch in der letzten Phase III der klinischen Entwicklung ist Biontech derzeit mit zwei Wirkstoffen vertreten. Diese sind jedoch keine Eigenentwicklungen, sondern Zukäufe der Firmen Duality Bio (China) beziehungsweise OncoC4 (USA). Damit verhält sich Biontech seiner Größe entsprechend bei dem Einkauf externer Innovation schon wie die TOP-20-Big Pharmas.
Sahins Verständnis von erfolgreicher Krebstherapie ist Schritthalten zu wollen mit der evolutiven Kraft des durch Mutationen und Resistenzen voranschreitenden Krankheitsgeschehens und immer eine nächste passende Antwort parat zu haben. Mit der breiten Pipeline können „die vielversprechendsten Behandlungsstrategien für bestimmte Patientengruppen verschiedenster Krankheitsstadien ermittelt und behandelt werden“, heißt es dazu aus dem Unternehmen (siehe |transkript 4/24).
Strahl, Gift und CAR-T
Das einzige weitere Unternehmen, das aus der Phase III ebenfalls mit einer baldigen Zulassung rechnet – wenn denn die bisher Anfang 2025 nur kryptisch bekanntgegebenen Topline-Daten auch unter dem strengen Auge der Behörden Anerkennung finden –, ist die Münchner Isotopenfirma ITM SE. Deren Radiopharmakon gegen gas-trointestinalen Krebs steht im direkten Wettbewerb mit einem zugelassenen Präparat von Novartis, für die ITM zugleich der Isotopen-Lieferant ist. Eine Zwickmühle, die wohl zur Zurückhaltung beim Hinausposaunen von zulassungsrelevanten Daten führte. Es gibt weitere Radioliganden-Unternehmen in Deutschland – frisch börsennotiert ergänzt durch die PentixaPharm AG, die dabei hofft, mit einem Radio-Diagnostikum schon bald in den Bereich eines Zulassungsverfahren vorzudringen und damit das Therapeutikum im Schlepptau zu beschleunigen.
Zwei größere Gruppen der therapeutischen Ansätze in der ganzen DACH-Region finden sich im Bereich der Zelltherapien sowie der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die förmlich wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Ähnlich dem Grünen Knollenblätterpilz, der sein Zellgift Amanitin dem Unternehmen Heidelberg Pharma zur Verfügung stellt, das derzeit noch in der Dosiseskalationsstudie versucht, die angemessene Konzentration für eine wirksame Therapie herauszufinden. Weiter ist da die Schweizer ADC Therapeutics, die ihr ADC schon von der FDA zugelassen bekommen hat und derzeit in Europa die erteilte konditionale Zulassung durch weitere Daten zu untermauern versucht.
Auch Fragmente von Antikörpern und speziell gestrickte Proteinformate sowie Klebstoffe (Glues) und Proteinzerstörer (Degrader) sind im Kommen wie auch Genom-Editierungsansätze von Seamless Therapeutics, Akribion oder auch der Lego-mRNA-Ansatz von SRDT Biotech aus Jülich. All dies befindet sich jedoch noch in der frühen Entwicklung.
Früher Vogel ohne Wurm
Das im Patentreport des EPA angesprochene Dilemma der drei Länder wird in der folgenden Tabelle deutlich: Zwar patentiert die Wissenschaft in Europa fleißig und ist damit offensichtlich durchaus wettbewerbsfähig. Doch die Start-ups rings um solche Patente bleiben dann zu lange in den frühen Phasen hängen. So zieht der besser finanzierte Wettbewerb vorbei und ein neuer Fokus muss gesetzt werden. Viele Firmen müssen sogar einen kompletten Strategiewechsel auf der Wegstrecke vollziehen. Und auch in aussichtsreicher Position wie bei der Heidelberger Apogenix gehen einfach mal die Gelder und damit die Lichter aus.
Um in die bedeutenden, entscheidenden und werthaltigen klinischen Phasen zu kommen brauchte es viel mehr Geld am Anfang. Um Geld zu sparen, könnte die Gründung etwas länger aufgeschoben werden, bis die relevante klinische Prüfung in Sichtweite ist, wie das Bert Klebl, Leiter des Dortmunder Lead Discovery Centers (LDC) anmahnte (siehe |transkript 3/24).
Ganzer Artikel und Übersichtstabelle der klinischen Entwicklung der Biotechnologiefirmen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit rund 50 Unternehmen und der Auflistung ihrer Pipeline
Auflistung der Biotechnologiefirmen in der früheren Phase: Präklinik
Neben den Unternehmen, die bereits Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung haben (siehe folgende Tabelle) gibt es eine große Zahl an Start-ups in der Präklinik (Auswahl): 3bp Berlin (D), Adoram Therapeutics SA, Art Bio GmbH, ATLyphe AG, Aukera Therapeutics (alle CH), Captain T-Cell GmbH (D), Cimeio GmbH (CH), Disco Pharma (D), Engimmune, FoRx Therapeutics, Haya Therapeutics (alle CH), Indivumed Therapeutics (D), Kupando (D), Onco One R&D GmbH (A), Plectonic (D), Pramomolecular (D), Proteros (D), Proxygen (A), Qli5 Therapeutics (D),Tacalyx (D), Tigen Pharma SA (CH), Valanx Biotech (A), WM Therapeutics (D), Ygion Biomedical (A), Yumab/Inscreenex (D), Ymmunobio AG (CH)
Der Artikel von Redaktionsleiter Dr. Georg Kääb stammt aus |transkript Heft 1/25 und erschien Ende Februar 2025.

 Tourismus Salzburg, Foto: Breitegger Günter
Tourismus Salzburg, Foto: Breitegger Günter  Athos Holding
Athos Holding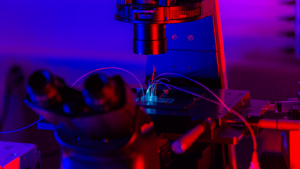 Memo Therapeutics AG
Memo Therapeutics AG